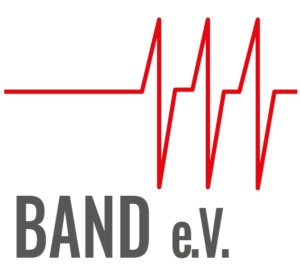8. Leinsweiler Gespräche der agswn e.V. in Zusammenarbeit mit INM, IfN und BAND, 04.- 05. Juli 2003
Das „therapiefreie Intervall“ als Zeitspanne zwischen Eintritt des Notfalles und Beginn qualifizierter Hilfe ist entscheidend für das Überleben und die Prognose des Notfallpatienten. Es ist Aufgabe der Notfallmedizin, nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, das therapiefreie Intervall so weit als möglich zu verkürzen.
Flächendeckende Notfallversorgung – Sicherstellung mit welchen Strukturen ?
T. Schlechtriemen1, Chr.-K. Lackner2, Hp Moecke3, D. Stratmann4, KH Altemeyer1
1 Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie, Klinikum Saarbrücken
2 Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM), Klinikum der Universität München
3 Klinikum Nord –Ochsenzoll, LBK Hamburg
4 Institut für Anästhesiologie, Klinikum Minden
Das „therapiefreie Intervall“ als Zeitspanne zwischen Eintritt des Notfalles und Beginn qualifizierter Hilfe ist entscheidend für das Überleben und die Prognose des Notfallpatienten. Es ist Aufgabe der Notfallmedizin, nach Wegen und Möglichkeiten zu suchen, das therapiefreie Intervall so weit als möglich zu verkürzen.
Die 8. berufspolitische Tagung der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte (agswn e.V.) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) des Klinikums der Universität München, dem Institut für Notfallmedizin (IfN), Hamburg und der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands (BAND e.V.) beschäftigte sich daher in drei Themenblöcken mit Möglichkeiten zur Verkürzung des therapiefreien Intervalls. Zum einen wurden neue Ansätze bei der Laienhilfe und dem Einsatz von First respondern diskutiert, zum anderen die aktuellen Strukturen des Rettungsdienstes kritisch auf ihre Zukunftsfähigkeit hinterfragt. Im letzten Themenblock beschäftigte man sich mit den Strukturen des erweiterten Rettungsdienstes an der Schwelle zum Katastrophenschutz.
Teilnehmer der Veranstaltung waren Vertreter der für den Rettungsdienst zuständigen Ministerien der Länder, der Bundesärztekammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Hilfsorganisationen und Feuerwehren sowie der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte (Tabelle 1).
Laienhilfe – neue Ansätze?
Zu Beginn der Gesprächsrunde unter Vorsitz von W. Dick(Mainz) und K.-H. Altemeyer (Saarbrücken) stellten drei Referenten in Kurzreferaten Ansätze für die Weiterentwicklung der Laienhilfe vor.
Deutschland verfügt –so referierte Th. Schlechtriemen (Saarbrücken) im Eingangsreferat- über ein gut ausgebautes bodengebundenes wie luftgestütztes Rettungssystem mit in den jeweiligen Landesrettungsdienstgesetzen definierten einsatztaktischen Vorgaben. So ist beispielsweise im saarländischen Rettungsdienstgesetz eine Hilfsfrist von 12 Minuten (erster Klingelton der Telefonanlage der Rettungsleitstelle bis Eintreffen des Rettungsteams an der Notfallstelle) und ein Sicherheitsniveau von 95% (nur in 5% darf ein Notfall nicht direkt bedient werden können, weil das nächstgelegene Rettungsmittel bereits im Einsatz ist) festgelegt. In zeitkritischen Notfallsituationen ist jedoch auch eine Hilfsfrist von 12 Minuten zu lang. Während beispielsweise die anfängliche Überlebensrate bei Kammerflimmern 90% beträgt, fällt sie pro Minute um etwa 10%. Mit gravierenden neurologischen Schäden ist ab der 4. Minute nach Herzstillstand zu rechnen. Notfallzeugen haben in dieser Konstellation bei adäquaten Ersthelfermaßnahmen eine gute Chance, dem Patienten suffizient zu helfen –der in der Regel später eintreffende Rettungsdienst hat deutlich schlechtere Ausgangsbedingungen. Eine weitere Verkürzung der Hilfsfrist für den organisierten Rettungsdienst ist aus organisatorischen und ökonomischen Gründen nicht umsetzbar. Das therapiefreie Intervall kann damit nur sinnvoll weiter verkürzt werden durch eine suffiziente Laienhilfe und ein strukturiertes Ersthelferkonzept. Essentiell ist es, in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Laienhilfe zu schaffen –Hilfe bei Notfällen muss selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Miteinanders werden. Nicht allein der Staat darf –quasi als Generalversicherer für alle Eventualitäten des Lebens- für die Notfallhilfe verantwortlich gemacht werden, sondern jeder einzelne Bürger sollte sich seiner sozialen Verantwortung für den Mitmenschen bewusst sein und Bereitschaft zeigen, aktiv –etwa durch Besuch entsprechender Ausbildungsveranstaltungen- seine Fähigkeiten in der Ersten-Hilfe auf einem ausreichenden Niveau zu halten.
Ein Eckpunkt derartiger Konzepte ist die Erste-Hilfe Ausbildung in den Schulen, die durchaus schon im Kindergarten beginnen kann. Schlechtriemen stellte die Erfahrungen eines Pilotprojektes im Saarland vor. Wichtig für die Entwicklung eines Unterrichtskonzeptes ist:
- Geeignete Zielgruppe(4. Klassenstufe der Grundschule, die Schüler sind in der Lage, die Lerninhalte zu erfassen und haben ein hohes Begeisterungspotential)
- Zielgruppenorientiertes Unterrichtskonzept(Umfang: 4 Doppelstunden, Anbindung an die Verkehrserziehung, als fakultatives Angebot)
- Notfallrelevanz des Unterrichtsstoffes(keine „Wickelkurse“ für Verbände, sondern Reduktion des Unterrichtsstoffes auf Maßnahmen zur Sicherung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und das korrekte Absetzen eines Notrufes)
- Breitenwirkung (Unterricht durch die Grundschullehrer selbst im Sinne eines Mediatorenkonzeptes mit entsprechender Vorbereitung der Lehrer in zentralen Fortbildungsveranstaltungen
- Mediale Unterstützungder Lehrkräfte durch spezielle Unterrichtsmaterialien (Schülermappe, Lehrermappe mit Hintergrundinformationen, Unterrichtsmedien und Elternbrief) sowie Übungsgeräte (z.B. zentral ausleihbare Reanimationsphantome)
- politische Unterstützungdurch zuständige Ministerien, Träger des Rettungsdienstes, Feuerwehren und Hilfsorganisationen
In der Diskussion wurde die Notwendigkeit, mit einer Ausbildung zur Ersten-Hilfe bereits in Kindergarten und Schule zu beginnen, von allen Diskussionsteilnehmern nachdrücklich unterstützt und folgende Eckpunkte für ein Unterrichtskonzept favorisiert:
- Kürze (6-8 Unterrichtsstunden)
- altersgerechtes und an den Möglichkeiten der Schule orientiertes Unterrichtskonzept
- Inhalt: Fähigkeiten zur Sicherung der Vitalfunktionen (Notruf, stabile Seitenlage, Basisreanimation –inklusive AED- Schockbekämpfung/Blutstillung mit einfachen Mitteln)
- Häufige Wiederholung
Der Inhalt der Kurse ist nach Überzeugung der Diskussionsteilnehmer weit wichtiger als die Form –so sind von Lehrern im Sinne eines Multiplikatorenkonzeptes durchgeführte Ausbildungen genauso denkbar wie ein Erste-Hilfe-Unterricht durch Ausbilder der Hilfsorganisationen. Die gesetzlichen Vorgaben für Erste-Hilfe-Kurse (8 Doppelstunden) oder den Kurs für lebensrettende Sofortmaßnahmen (LSM-Kurs, 4 Doppelstunden) sind für andere Zielgruppen –etwa die Führerscheinbewerber- erstellt und entsprechen nicht den Bedürfnissen der Schulen.
In die Finanzierung der Ersten-Hilfe Ausbildung in der Schule könnten –wie im saarländischen Pilotprojekt- private Sponsoren und öffentliche Stiftungen eingebunden werden. Auch ein Engagement der Eltern –etwa über den Schulförderverein wäre denkbar.
Erste-Hilfe-Ausbildung in der Schule sollte attraktiv und ideenreich sein. So ist eine Einbindung von Erste-Hilfe Themen in den laufenden Unterricht, etwa in den Sachkundeunterricht der Grundschule oder die naturwissenschaftlichen Fächer der weiterführenden Schulen sowie den Sportunterricht (hier beispielsweise wiederholtes Üben der stabilen Seitenlage) sinnvoll.
In den Kultusministerien ist Überzeugungsarbeit für derartige Konzepte zu leisten –Vorurteile („Hilfsorganisationen wollen Verbandskurse anbieten und Geld verdienen) müssen abgebaut werden. Zum Teil gibt es in den zuständigen Ministerien erhebliches Interesse an der Thematik, das über die Einbindung der Politik und der Elternvertreter weiter gesteigert werden sollte. Von den Diskussionsteilnehmern wurde angeregt, eine Arbeitsgruppe aus dem Kreis der Teilnehmer zu bilden, die den Kontakt zur Kultusministerkonferenz sucht und hier das Thema „Erste-Hilfe-Ausbildung in der Schule“ erneut vorbringt.
In der Bevölkerung besteht eine hohe Zustimmung über die Notwendigkeit einer Ersten-Hilfe Ausbildung in der Schule (96% der Befragten äußerten sich entsprechend in einer Studie des Institut für Rettungsdienst es DRK –7) –dies ließe sich insbesondere in der Argumentation gegenüber der Politik nutzen.
S. Topp(Berlin) stellte im Anschluss die Konzeption des Deutschen Roten Kreuzes für die Breitenausbildung in Erster-Hilfe vor.
Die Ausbildung in Erster-Hilfe erfolgt unter dem Gesamtaspekt des lebenslangen Lernens –die Ausbildung von Jugendlichen wird dabei nicht unerheblich auch unter dem Aspekt der Gewaltprävention gesehen: „Wer hilft, wirft keine Steine“. Das Lehrgangsangebot des DRK ist breit gefächert und hat im Jahre 2000 mehr als 1.000.000 Lehrgangsteilnehmer erfasst. Es umfasst zum Beispiel:
- lebensrettende Sofortmaßnahmen (8 UE)
- Erste-Hilfe Grundausbildung (16 UE)
- Erste-Hilfe-Training (8 UE)
- Erweiterte Erste-Hilfe (San-A 24 UE)
- Erste-Hilfe fresh-up (4 UE)
- Früdefibrillation (8 UE)
Zur Finanzierung dieser Ausbildungen stehen in immer geringerem Umfang staatliche Zuschüsse zur Verfügung. Einige Ausbildungsmaßnahmen werden durch Unfallversicherungsträger (Berufsgenossenschaften) gefördert. Die meisten Ausbildungsangebote sind jedoch ganz oder zum größten Teil privat zu finanzieren.
Konzepte zur Erste-Hilfe Ausbildung spezieller Zielgruppen –etwa von Schülern im Rahmen des Schulunterrichtes- liegen vor und können im Sinne eines Modularsystems an die unterschiedlichen lokalen Bedürfnisse angepasst werden. Die Ausbildung sollte durch Ausbilder der Hilfsorganisationen nach einheitlichem Konzept durchgeführt werden –eine Schulung von Lehrern im Sinne eines Multiplikatorenkonzeptes ist nicht vorgesehen.
Eine staatliche Unterstützung des Erste-Hilfe-Unterrichtes in der Schule erfolgt bisher nicht –hier müssten alternative Finanzierungsmodelle (Spenden, Unterstützung durch Schulförderverein, Elternbeitrag) diskutiert werden.
Aus Sicht des DRK sollte das Konzept des „lebenslangen Lernens“ konsequent umgesetzt werden, was für die Erste-Hilfe Ausbildung in der Schule bedeutet:
- Beginn in der Altergruppe < 10 Jahre und Fresh-up-Kurse für die Altersgruppe > 16 Jahre
- EH-Ausbildung ( inklusive Zusatzqualifikation AED) als integraler Bestandteil der Schulcurricula
- Ausreichende staatliche Förderung
Von den Diskussionsteilnehmern wurde das modulare, auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen eingehende Breitenausbildungskonzept der Hilfsorganisationen klar unterstützt und angeregt:
- Insbesondere die Präsenz der Thematik in den Medien (Kinderkanal, Servicesendungen, aber auch analog zum Produktplacement der Industrie z.B. Reanimation im „Tatort“) auszubauen
- Ideenreichtum bei der Vermittlung von Erste-Hilfe-Themen zu entwickeln –z.B. EH-Kurse im Kinderbetreuungsprogramm von Ferienveranstaltungen, Kursangebot in Einrichtungen der Erwachsenenbildung und Volkshochschulen, Kursangebot für Sporttrainer oder „TÜV für Autofahrer“ (Fahrzeug wird technisch überprüft, Fahrer erhält Auffrischung seiner Erste-Hilfe-Kenntnisse)
Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, das die AED-Anwendung schnellstmöglich Teil der EH-Ausbildung werden sollte und man sich im Kursformat beschränkt auf Maßnahmen die belegtermaßen das therapiefrei Intervall verkürzen, insbesondre die CPR-Maßnahmen.
Den Stellenwert der AED (Automatisierten externen Defibrillation) für die Laienhilfe (als PAD – Public access defibrillation) und im Rahmen der Frühdefibrillation (early defibrillation) stellte B. Dirks (Ulm) dar.
Die PAD ist von der Frühdefibrillation durch Mitarbeiter des regulärer Rettungsdienstes oder organisiert im Rahmen öffentlicher Aufgaben alarmierten Ersthelfern mit spezieller Ausbildung (First-responder, Feuerwehr, Polizei) abzugrenzen. Hier sollten strukturierte Frühdefibrillationsprogramme eingeführt und die Ausrüstung beispielsweise aller Krankentransportwagen mit AED-Geräten eine Selbstverständlichkeit sein.
Personengruppen, für die der Einsatz einer PAD in Frage kommt, sind demgegenüber:
- Motivierte, trainierte Ersthelfer außerhalb eines öffentlichen Sicherheits- oder Hilfeleistungssystems wie bspw. Altenpfleger, Betriebsersthelfer oder Sporttrainer (targeted responders)
- Laienhelfer –zufällig anwesende, möglicherweise untrainierte Helfer
- Angehörige von Risikopatienten
Vielfältige Erfahrungsberichte (1, 6, 9) haben gezeigt, dass medizinische Laien nach entsprechender Unterweisung im Rahmen der Reanimation die automatisierte externe Defibrillation sicher und erfolgreich durchführen können. Hierdurch wurde die Überlebensrate in den entsprechenden Studienkollektiven erheblich gesteigert.
Nur 20% der Herz-Kreislauf-Stillstände finden jedoch im öffentlichen Verkehrsraum statt und sind so einer PAD grundsätzlich zugänglich. Die Platzierung von AED-Geräten an Orten mit bekannt hoher Inzidenz von Kreislaufstillständen oder hohem Publikumsverkehr ist eine sinnvolle Strategie zur Verbesserung der Reanimationserfolge.
Voraussetzung für die Anwendung eines AED-Gerätes ist eine adäquate Ausbildung um die Rechtswidrigkeit der Körperverletzung zu rechtfertigen. Jede Institution, die die AED durch Laien in ihrem Bereich einführt, hat die ärztliche Fachaufsicht sicherzustellen und ein Schulungsprogramm zu implementieren. Bei jedem Einsatz des AED ist zeitgleich der Rettungsdienst zu alarmieren und nachträglich im Rahmen eines Qualitätsmanagementprogrammes die AED-Anwendung unter ärztlicher Fachaufsicht zu analysieren.
Kritisch diskutiert wird der Umfang der zur Anwendung der AED-Geräte im Rahmen der PAD notwendigen Ausbildung:
- Die Einweisung in die Gerätefunktion selbst bedarf wenig Zeit. Nach kurzer Einweisung (etwa durch ein Video) sind selbst Grundschüler in der Lage, das AED-Gerät adäquat zu nutzen (2, 4).
- Die Anwendung des AED-Gerätes macht für den Patienten nur dann Sinn, wenn parallel die Basismaßnahmen der kardiopulmonalen Reanimation adäquat durchgeführt werden –ihr Training bedarf eines größeren Zeitbedarfs (theoretische Grundlagen, praktische Übungen; [5] )
- Die Bundesarbeitsgemeinschaft Erste-Hilfe (BAGEH) sieht für die Ausbildung von Laien an AED-Geräten nach Abschluß eines 18stündigen Erste-Hilfe-Lehrgangs eine weitere 7stündige Spezialausbildung sowie einen jährlichen Auffrischkurs von 4 Stunden vor.
- Die Leitlinien der American Heart Association (AHA) sehen für Laien eine 3-4stündige Heartsaver-Ausbildung (Maßnahmen der Reanimation einschließlich AED-Schulung) vor, die für beruflich tätige Ersthelfer (z.B. Krankenpflegepersonal, Feuerwehrleute, Wachpersonal) noch einmal auf 1-2 Stunden AED-Ausbildung reduziert werden kann.
Zusammenfassend kann man sagen: AED-Ausbildung ist nur in Verbindung mit der Vermittlung der Basisreanimation sinnvoll. Die Ausbildungsanforderungen dürfen jedoch nicht so umfangreich sein, dass sie mögliche Interessenten abschrecken. Zur AED-Ausbildung von Laien genügen kurze, möglichst praktische Anwendungen, Wiederholungen sind effektiver als umfangreiche Ausbildungen.
Fazit Laienhilfe
Zur Verkürzung des therapiefreien Intervalls ist eine breite Ausbildung der Laien in Erster-Hilfe essentiell. Diese Ausbildung sollte sich inhaltlich auf Maßnahmen zur Stabilisierung der Vitalfunktionen (Notruf, stabile Seitenlage, Basisreanimation inklusive AED und Schockbekämpfung) beschränken. Mit Erste-Hilfe-Unterricht sollte in Kindergarten und Schule früh begonnen werden, häufige Wiederholungen sind wichtig. Die Ausbildungskonzepte müssen ideenreich die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen berücksichtigen. Ein modularer Aufbau der Ausbildung ist sinnvoll.
In der Öffentlichkeit muss ein Bewusstsein für Laienhilfe als selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Miteinanders geschaffen werden –die mediale Präsenz der Thematik sollte in unserer Mediengesellschaft verstärkt werden.
First responder
In zwei Eingangsreferaten wurden First-responder-Systeme in Bayern und Hamburg vorgestellt sowie in einem weiteren Referat die Möglichkeit der Einbindung von niedergelassenen Ärzten in diese Konzepte diskutiert.
In den Einsatzleitrechnern der Rettungsleitstellen sind in Bayern – so berichtet
M. Ruppert (München) in seinem Referat – knapp 300 First-responder bzw. „Helfer vor Ort“ – Systeme angelegt. Bei 440.000 gemeldeten aktiven Helfern in Hilfsorganisationen und Feuerwehren (damit kommt 1 Helfer auf etwa 30 Einwohner) bestehen erhebliche weitere Personalresourcen. Gerade im Bereich der Feuerwehren kann auch auf eine breite Verteilung von Einsatzstandorten (etwa 9.000 in Bayern) zurückgegriffen werden.
First-responder bzw. „Helfer vor Ort“ sind in Bayern nicht Teil des öffentlichen Rettungsdienstes, werden jedoch weit überwiegend über die Rettungsleitstellen alarmiert. Diese kann die Alarmierung nach Art. 20 Abs. 3 Satz 7 BayRDG nur mit Zustimmung des Rettungszweckverbandes übernehmen. Die Alarmierungsbereitschaft ist unterschiedlich –zum Teil kann keine 24-stündige Einsatzbereitschaftsdienst organisiert werden.
Die Organisationsstrukturen der First-responder-Systeme sind regional sehr verschieden. Die Ausbildung erfolgt
- meist orientiert am AED-Konzept für den Rettungsdienst
- bei den Hilfsorganisationen durch eigene Ausbilder, bei den Feuerwehren zumeist durch externe Ausbilder
- z.T. ohne (aktive) ärztliche Ausbildungsbeteiligung bzw. Programmleitung aber z.T. auch unter Einbindung des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) inklusive medizinischem Qualitätsmanagement
Der Ausbildungsumfang und die –inhalte orientieren sich in vielen Systemen an der Sanitätsausbildung mit einem Umfang von 80 – 100 Stunden. Andernorts wird ein für die spezifischen Aufgaben zielorientiertes Curriculum mit einem Umfang von 40 – 50 Stunden umgesetzt. Diese Ausbildung umfasst in erster Linie:
- Diagnostik von Vitalfunktionsstörungen
- Basisreanimation inklusive AED
- Atemwegsmanagement, Sauerstoffapplikationstechniken
- Lagerungsmaßnahmen, Immobilisation und Blutstillung
Nicht Inhalt dieser First-responder-Ausbildung ist die Vermittlung von Maßnahmen ohne lebensrettendes Potential oder von assistierenden Maßnahmen (Vorbereitung Infusion, Medikamente, Intubation etc.).
Die Ausstattung der bayerischen First-responder-Systeme schwankt zwischen einem auf die Ausrüstung für lebensrettende Sofortmaßnahmen beschränkten Umfang (AED, Beatmungshilfen) bis hin zu einer, dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) vergleichbaren Ausstattung. Als Einsatzfahrzeuge für First-Responder bzw. „Helfer-vor-Ort“ Aufgaben stehen Einsatzleit- und Mannschaftswagen oder organisationseigene KTW und RTW zur Verfügung. Zum Teil gibt es eigens für diesen Aufgabenbereich angeschaffte Fahrzeuge, zum Teil werden Privatfahrzeuge genutzt.
Das Einsatzspektrum bzw. die Einsatzindikation differiert ebenfalls entsprechend den örtlichen Gegebenheiten. Einige Systeme werden grundsätzlich bei jeder Indikation des Notarzteinsatz-Indikationskataloges alarmiert. Dies führt zu einer hohen Einsatzbelastung (Auswirkung auf den Hauptberuf des Helfers) bei großem Einsatzspektrum (fraglicher Benefit für den Patienten bei einem Teil der Einsätze). Andere Systeme werden nur bei Reanimationsverdacht alarmiert, wobei zu hinterfragen ist, ob eine derartige Beschränkung des Einsatzspektrums nicht zu schmal dimensioniert ist und ob die Notfallmeldung ausreichend spezifisch ist um die tatsächlichen Reanimationsfälle herauszufiltern. In einigen First-responder Systemen erfolgt die Alarmierung auch zu nicht-lebensbedrohlichen Notfallsituationen, wenn ein sehr langes Reaktionsintervall des Rettungsdienstes zu erwarten ist (z.B. Kollaps, leichtere Verletzungen etc.).
Für den städtischen Einsatzraum legte P. Rechenbach (Hamburg) am Beispiel von Hamburg die Einsatzmöglichkeiten von First-responder Systemen dar.
In den zum Teil ländlich strukturierten Randbezirken von Hamburg lässt sich die innerstädtisch angestrebte Hilfsfrist von 8 Minuten für den Rettungsdienst (vom Eingang des Notrufes bis zum Eintreffen am Schadensort) nicht oder nur mit nicht vertretbarem Aufwand umsetzen. Dies gilt insbesondere auch für durch die Elbe abgeschnittene Stadtbereiche. Hier werden First-responder-Einheiten der freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. Das in diesen Einheiten eingesetzte Personal erhält eine 14tägige komprimierte Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule, die folgende Themen abdeckt:
- Grundlagenausbildung
- Reanimation Erwachsene / Kinder inklusive umfangreiche praktische Ausbildung
- Häufige, vitalbedrohende Erkrankungen und Verletzungen
- Geräte- und Fahrzeugtechnik
Die einzelnen First-responder-Systeme sind mit Einsatzkoffern für Grund- und Wundversorgung sowie einem AED-Gerät und einem Beatmungsgerät ausgerüstet.
In der Diskussion wurde auf eine dem Auftrag adäquate Ausbildung und Ausrüstung der First-responder-Systeme besonderer Wert gelegt. First responder sollen und können keinen Parallelrettungsdienst darstellen, sondern die Zeitspanne bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes suffizient überbrücken –hier ist insbesondere die Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen inklusive AED, Masken-Beutel-Beatmung und Sauerstoffgabe zu nennen (schlagwortartig: „Strom und Sauerstoff“).
Juristisch ist –so ein Diskussionsbeitrag von M. R. Ufer (Göttingen) – das First-responder-System als eine Optimierungsstrategie für den Rettungsdienst zu werten und verändert die Verpflichtung zur Einhaltung der in den meisten Bundesländern durch Gesetz, Verordnung oder Plan vorgegebenen Hilfsfrist für den Rettungsdienst, der diese durch Krankenkraftwagen oder Notärzte erfüllt, nicht. Organisierte First-responder-Systeme, die sich im Auftrag des Rettungsdienstträgers bereithalten und durch eine Rettungsleitstelle eingesetzt werden, sind gleichwohl als funktioneller Bestandteil des Rettungsdienstes einzuordnen, was in den meisten Bundesländern zur Folge hat, dass Schadensfälle nach Amtshaftungsgrundsätzen abzuwickeln sind. Zu diesem Punkt gibt es jedoch noch Klärungsbedarf – das Land Bayern prüft diese Fragestellung zur Zeit.
K. Jörg(Saarbrücken) trug im Anschluss einige Gedanken zur Einbindung von niedergelassenen Ärzten in First-responder-Systeme vor und stellte zunächst fest, dass aufgrund einer bundesweit flächendeckenden Versorgung mit niedergelassenen Ärzten und der daraus resultierenden kurzen Entfernung die Kollegen oft schneller am Notfallort sind als der Notarzt. Insoweit stellen niedergelassene Ärzte eine potentielles First-responder-System dar.
Die meisten der niedergelassenen Kollegen, vor allem die jüngeren, sind kompetent in der Behandlung von Notfällen und verfügen über eigene Einsatzkoffer zur Beatmung. Die wenigstens jedoch besitzen bisher tragbare Defibrillatoren –eine zusätzliche Ausrüstung –etwa mit AED-Geräten- wäre zu überdenken. Aber auch ohne spezifische Ausrüstung sind niedergelassene Ärzte aufgrund ihrer Ausbildung effektiver im Handling von lebensbedrohlichen Notfällen als Laien. Während der Sprechstundenzeiten kann auch eine kompetente Arzthelferin mit zum Notfallort genommen werden.
Größter Schwachpunkt ist die Erreichbarkeit. Die eingehenden Telefonleitungen der Praxen sind meist blockiert durch anrufende Patienten. Die meisten Praxen verfügen über eine zweite eingehende Leitung, die jedoch nicht publiziert ist. Die Versorgung der niedergelassenen Ärzte mit Mobiltelefonen ist flächendeckend. Es wäre denkbar, dass die Rettungsleitstelle auf einer elektronischen Karte ähnlich wie die Rettungswachen alle niedergelassenen Ärzte mit Praxissitz und (Mobil-)Telefonnummern gespeichert hat und die Fernmeldeverbindung mittels Mausklick herstellt. Voraussetzung für die Einbindung der niedergelassenen Kollegen in die Notfallversorgung durch die Rettungsleitstelle ist deren Einverständnis, in ein solches Alarmierungssystem aufgenommen zu werden.
Fazit First responder
Die regionalen rettungsdienstlichen Strukturen und die Prozessqualität müssen von dem verantwortlichen ÄLRD untersucht werden, um auf der Basis dieser Ergebnisse die Notwendigkeit und den Nutzen einer Ergänzung des Rettungsdienstes durch First-responder-Systeme zu identifizieren. Hieraus ergibt sich das Einsatzspektrum und die Einsatzindikation für das örtliche First-responder-System mit konsekutiven Vorgaben für die Ausbildung und die Ausrüstung des Systems.
Insbesondere ist die Optimierung vorhandener Strukturen (z.B. Ausrüstung von KTWs mit AED-Geräten, Frühdefibrillationsprogramme) und der Rückgriff auf kompetente Partner (niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Polizei) in Betracht zu ziehen.
First-responder-Systeme ergänzen den Rettungsdienst, können ihn jedoch keinesfalls ersetzen und verändert die Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist durch den Rettungsdienst nicht.
Grundlagen für neue Strukturen im Rettungsdienst
Die Qualifikation des Personals im Rettungsdienst ist aufgrund des zunehmenden Ärztemangels wie der Überlegungen zur Modifikation der Rettungsassistentenausbildung in die aktuelle Diskussion geraten. Daher beschäftigten sich im zweiten Tagungsabschnitt unter dem Vorsitz von F.-W. Ahnefeld (Ulm) und R. Müller (Potsdam) zwei Referate mit diesem Themenkomplex als wichtige Komponente der Strukturqualität des Rettungsdienstes. Abschließend beleuchtete Lackner (München) als Ausblick Eckpunkte für neue rettungsdienstliche Konzepte.
K.-H. Altemeyer(Saarbrücken) stellte an den Beginn seines Referates das Fazit des Reisensburger Memorandums 1996: „ Dauer und Strukturierung der Rettungsassistentenausbildung nach dem Rettungsassistentengesetz von 1989 entsprechen nicht den Erfordernissen“. Probleme des Rettungsassistentengesetzes von 1989 sind insbesondere:
- Keine Verzahnung zwischen theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitten –in der Theorie erlerntes Wissen kann so nicht unmittelbar praktisch umgesetzt werden.
- Keine einheitlich strukturierte Ausbildung -dies ist mittlerweile durch das 1999 eingeführte gemeinsame Curriculum der Hilfsorganisationen und Berufsfeuerwehren zur Rettungsassistentenausbildung entschärft
- Zu hoher Anteil verkürzt ausgebildeter oder übergeleiteter Rettungsassistenten –Schätzungen der Hilfsorganisationen gehen von einem Anteil von mehr als 2/3 aller zur Zeit berufstätigen Rettungsassistenten mit einer derartigen Ausbildung aus
- Probleme der Qualitätssicherung in Schule, Klinik und Lehrrettungswache –die Schulen nehmen oftmals keinen Einfluss auf die praktische Ausbildungsphase, so dass die Qualität der Ausbildung in Klinik und Rettungswache in keiner Weise kontrolliert wird
- Unzureichende Finanzierung der Rettungsassistentenausbildung –die meisten Auszubildenden müssen immer noch die Kosten ihrer Ausbildung ganz oder teilweise selber tragen.
Nach einem erneuten Symposium auf der Reisensburg in 2001 sind unter Federführung des Deutschen Städtetages wichtige Eckpunkte für die Novellierung vorgelegt worden:
- Eingangsvoraussetzung: Mittlere Reife oder vergleichbarer Schulabschluss
- Mindestalter 17 Jahre
- Ausbildung im alternierenden Modus (Blöcke theoretischen Unterrichts wechseln sich mit praktischen Unterrichtsteilen in Klinik und Lehrrettungswache ab) mit staatlicher Abschlussprüfung zum Ausbildungsende nach drei Jahren
Ziel dieses Ausbildungskonzeptesist es, dem Auszubildenden die Qualifikation für eine fachgerechte, selbstständige Notfallversorgung von Patienten, die nicht vital bedroht sind oder deren Verletzung oder Erkrankung nicht zu bleibenden Schäden führt (ASA I- III) zu vermitteln. Gleichzeitig soll er befähigt werden, die fachgerechte Erstversorgung vital bedrohter Patienten (NACA IV und VI) sowie die Erstbehandlung dieser Patienten bis zum Eintreffen des Notarztes als Regelkompetenz durchzuführen. Eine derart verstandene Regelkompetenz umfasst im einzelnen:
- Diagnostik der vitalen Funktionen und Basisuntersuchung
- Lebensrettende Sofortmaßnahmen
- Immobilisation, pflegerische und betreuende Maßnahmen
- Patiententransport (Vorbereitung und Durchführung)
- Feststellung einer Arbeitsdiagnose bei Notfallpatienten
- EKG-Ableitung mit Basisinterpretation
- Erweiterte Reanimation mit Defibrillation und Medikation
- Intubation in ausgewählten Situationen
- Legen eines periphervenösen Zuganges und Infusion von Elektrolytlösungen
- Applikation ausgewählter Medikamente
Erst nach einer Novellierung des Rettungsassistentengesetzes mit entsprechender Ausbildung über 3 Jahre kann die Regelkompetenz für Rettungsassistenten in Kraft gesetzt werden. Bis derartig ausgebildete Rettungsassistenten in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, werden 6-10 Jahre vergehen. Bis dahin haben die aktuellen Regelungen bezüglich der Notkompetenz für Rettungsassistenten Bestand.
Nach dieser Übersicht zu den sich abzeichnenden Veränderungen in der Rettungsassistentenausbildung setzte sich Th. Schlechtriemen (Saarbrücken) mit der aktuellen Diskussion über die Auswirkungen des Ärztemangels auf die präklinische Notfallversorgung auseinander.
Die Verschärfung der Zugangsvoraussetzungen zum Notarztdienst durch Einführung der Zusatzweiterbildung Notfallmedizin, die in einigen Landesärztekammern bereits eingeführt und beim Deutschen Ärztetag 2003 offiziell verabschiedet worden ist, treffen bei den Verantwortlichen in einigen Notarztstandorten, die zunehmende Probleme bei der Besetzung des Notarztdienstes haben, auf stärker werdende Kritik. Eine Verknüpfung der notärztlichen Qualifikation mit dem gegenwärtigen Ärztemangel ist jedoch weder sinnvoll noch zulässig.
Die Qualifikation eines Notarztes muss sich an seinem Tätigkeits- und Verantwortungsbereich orientieren, der gekennzeichnet ist durch:
- Eine uneingeschränkt eigenständige ärztliche Tätigkeit ohne Rückfallebene – es kann weder im eigenen Fachgebiet auf die Unterstützung eines Kollegen (Oberarzt / Chefarzt) zurückgegriffen werden, noch bei fachfremden Notfällen (z.B. drohende Geburt) der Rat eines Konsilliarius eingeholt werden.
- Hochrisikopatienten –im Notarztdienst sind zumindest in einem nicht unerheblichen Teil der Fälle Hochrisikopatienten mit lebensbedrohlichen Krankheitsbildern zu versorgen, die einer zeitkritischen Intervention sowohl mental (Entscheidungsfindung) als auch manuell (Entscheidungsumsetzung) bedürfen.
- Widrige Umgebungsbedingungen –der Zugang zum Patienten ist oft eingeschränkt (z.B. Reanimation in beengten Wohnverhältnissen, eingeklemmte Traumapatienten), hohes Aspirationsrisiko bei nicht nüchternen Patienten
- Nervenstärke, Führungskraft und Durchsetzungsstärke sind erforderlich –etwa bei der Koordination vieler Rettungskräfte an einer Einsatzstelle oder bei der Übergabe eines Patienten in einer Zielklinik, die den Patienten nicht aufnehmen möchte.
Das so gekennzeichnete Anforderungsprofil an die notärztliche Tätigkeit entspricht –sieht man es einmal als Katalog für eine Stellenausschreibung in der Klinik- dem Tätigkeitsbereich eines Oberarztes, zumindest dem eines Facharztes. Der Facharztstatus als Mindestanforderung für den Notarztdienst lässt sich sicherlich nicht umsetzen, die in Abb. 2 dargestellten Anforderungen der Zusatzweiterbildung Notfallmedizin –insbesondere die 30monatige klinische Erfahrung vor Beginn der Notarzttätigkeit- sind unter diesen Gesichtspunkten sicherlich nicht überzogen.
Eine Reduktion der Qualitätsanforderungen an den notärztlichen Dienst kann nicht die Antwort auf den vorliegenden Mangel an qualifizierten Notärzten sein. Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung einer qualifizierten Notarztversorgung könnten sein:
- Ausdünnung der Standorte (Qualität vor Quantität) mit
- Verstärktem Nutzen der Kompetenz des Rettungsassistenten (unter den Vorgaben: 3jährige Ausbildung, Nutzen von standing-orders obligat unter Verantwortung eines ÄLRD)
- Einbindung des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes bzw. der niedergelassenen Ärzte –auf Dauer sind zwei getrennte, unkoordiniert nebeneinander ablaufende Systeme zur präklinischen Notfallversorgung ökonomisch wie organisatorisch nicht mehr haltbar
- Ausdehnung der Einsatzzeiten der Luftrettung in die einsatzstarken Zeiten des frühen Abends bis hin zu einer 24stündigen Einsatzbereitschaft
- Angemessene Bezahlung –dort, wo eine angemessene Vergütung erfolgt, besteht zur Zeit kein Notarztmangel
- Aufbau von Kompetenzzentren an größeren Kliniken mit satelitenartiger personeller Mitversorgung kleinerer Notarztstandorte der Umgebung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Strukturprobleme im Gesundheitswesen nicht durch Qualitätsverzicht lösen lassen. Es gilt vielmehr, die optimale Nutzung organisatorischer Ressourcen voranzutreiben und politischen Druck zum Erhalt sinnvoller Strukturen zu nutzen.
Fachkunde Rettungsdienst
|
|
| Fachkunde Rettungsdienst | Zusatzbezeichnung Notfallmedizin |
|
18 Monate klinische Tätigkeit davon 3 Monate Intensiv / Anästhesie / Notaufnahme |
30 Monate klinische Tätigkeit davon 6 Monate Intensiv / Anästhesie / Notaufnahme |
|
Einzelnachweise |
|
|
10 Einsätze NACA > IV unter Anleitung |
50 Einsätze unter Anleitung frühestens nach 18 Monaten |
|
Theoretischer Kurs (80 h) |
Theoretischer Kurs (80 h) frühestens nach 18 Monaten |
|
|
Prüfung vor Ärztekammer |
Abb 1:Vergleich der Anforderungen für die „Fachkunde Rettungsdienst“ und die „Zusatzbezeichnung Notfallmedizin“
Chr. K. Lackner(München) fasste zum Abschluss der Eingangsvorträge für die sich anschließende Diskussion die Eckpunkte neuer Konzepte im Rettungsdienst schlagwortartig zusammen. Entscheidende Eckpunkte sind:
- Qualität und Kosten
- Verkürzung des therapiefreien Intervalls
- Strukturqualität Personal
- Schnittstelle Rettungsdienst – Krankenhaus
Unter dem Aspekt „Qualität und Kosten“ ist kritisch zu hinterfragen:
- Wie kann die Qualität der rettungsdienstlichen Leistung valide und nachvollziehbar erfasst werden?
- Stimmen die gegenwärtigen Strukturen –etwa bei der Indikationsstellung für Notarzteinsätze (Problematik Leitstelle) oder der Aufgabenverteilung zwischen Notarztdienst und kassenärztlichem Bereitschaftsdienst?
- Wie lässt sich Kostentransparenz erreichen? Wie lassen sich in einem System mit hohem Anteil von Vorhaltekosten unternehmerische Anreize zur Kostenreduktion setzen? Wie kann man die Mitarbeiter vor Ort in die Finanzverantwortung mit einbeziehen und die win-win Situation (alle Beteiligten profitieren von einem hohen Einsatzaufkommen) durchbrechen?
Zum Eckpunkt „therapiefreies Intervall“ wurde in den vorangegangenen Vorträgen vieles bereits angesprochen, hier ist insbesondere zu diskutieren:
- Wie werden die gesetzlichen Planungsgrößen „Hilfsfrist“ und „Sicherheitsniveau“ flächendeckend umgesetzt?
- Können gestaffelte Hilfeleistungssysteme unter Einbeziehung einer suffizienten Laienhilfe und von First-respondern als „neue“ Glieder in der Rettungskette eine Antwort für die Verkürzung des therapiefreien Intervalls sein?
- Welche Rolle werden „back-up-Systeme“ (z.B. Hintergrundbereitschaften) zukünftig spielen?
Der Eckpunkt „Strukturqualität Personal“ wurde hinsichtlich der Aspekte „Qualifikation von nichtärztlichem und ärztlichem Personal im Rettungsdienst“ und „Rolle der Laienhilfe und der First-responder-Systeme“ bereits umfangreich diskutiert. Weitere Aspekte dieser Thematik wären:
- Welche Vorstellungen bestehen generell zur Personalkonzeption im Rettungsdienst –wollen wir eher Spezialisten, Allrounder oder Netzwerker?
- Welche Rolle werden zukünftig ehrenamtliche Strukturen im Rettungsdienst spielen?
Letztendlich ist die Schnittstelle des Rettungsdienstes zur Klinik ein weiterer wichtiger Eckpunkt von Zukunftsüberlegungen und es ist zu fragen:
- Wie reagiert der Rettungsdienst auf die zunehmende Zentralisation und Netzwerkbildung im Klinikbereich? Was ergibt sich hieraus insbesondere für den Interhospitaltransfer als rettungsdienstliche Leistung?
- Welche Lösungsansätze sind für das Problem der Reduktion von Kliniken mit Akutversorgung im Rahmen der gDRGs denkbar –hier fallen Kliniken sowohl zur Gestellung von Notärzten als auch als Zielklinik weg.
- Welche Rolle spielen bei Ausdünnung der präklinischen ärztlichen Notfallversorgung und Reduktion von Abteilungen zur Akutversorgung Post-primär-Konzepte (insbesondere auch unter Einbeziehung der Luftrettung)?
Diese pointierte Zusammenstellung von Problemkomplexen leitete über zur Diskussion im Plenum. Zentraler Punkt war hierbei die Diskussion von Lösungsansätzen zur Aufrechterhaltung einer qualifizierten und flächendeckenden Notarztversorgung. Hier wurde im Einzelnen diskutiert:
Aufgrund der gDRGs wird es zum einen zu einer Konzentration von Kliniken an weniger Standorten, zum anderen zu einem Verzicht mancher Klinik auf teure weil betriebswirtschaftlich schlechter kalkulierbare akutmedizinisch tätige Abteilungen geben –auch wenn entsprechend § 17b des Krankenhausfinanzierungsgesetzes ein Abschlag in der gDRG für die Häuser vorgesehen ist, die keine stationäre Notfallversorgung vorhalten. Folge für die Notfallmedizin ist, dass zum einen die möglichen Zielkliniken für Notfallpatienten weniger dicht gestreut sein werden, zum anderen geeignete Kliniken zur Gestellung von Notärzten fehlen. Darüber hinaus werden Kliniken nur bei kostenadäquater Honorierung weiterhin Ärzte für den Notarztdienst abstellen können – eine Kostenerstattung außerhalb der Krankenhausbudgetierung damit essentiell.
Insgesamt ist der Notarztdienst in vielen Regionen nicht adäquat finanziert – eine Verbesserung in diesem Bereich würde die Zahl der zur Verfügung stehenden Notärzte sicherlich erhöhen. In diesem Zusammenhang darf auch die Diskussion über hauptamtlich besetzte Notarztsysteme kein Tabuthema sein. Ein derartiges System ist aus dem Blickwinkel des Qualitätsmanagements eindeutig Systemen vorzuziehen, die mit einer unübersichtlich hohen Anzahl von nebenberuflich tätigen Ärzten („freelancer“) arbeiten. Gerade bei Rückgriff auf außerklinische Ressourcen kommt dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst in der Überwachung der Qualität der notärztlichen Versorgung eine entscheidende Rolle zu.
Insgesamt wurde aus dieser Diskussion deutlich, dass die strukturellen und betriebswirtschaftlichen Probleme nichts mit den Qualifikationsanforderungen an den Notarzt zu tun haben. Alle Diskussionsteilnehmer unterstützten uneingeschränkt die Notwendigkeit einer ausreichenden Qualifikation für den Notarztdienst, die mit der gerade vom Deutschen Ärztetag beschlossenen Zusatzweiterbildung Notfallmedizin umgesetzt werden soll.
In diesem Zusammenhang wies M. R. Ufer (Göttingen) auf den Rückhalt der Institution „Notarzt“ in den Rettungsdienstgesetzen und der gegenwärtigen Rechtsprechung hin. Zum Beispiel ist in § 3 Abs. 2 Satz 1 des schleswig-holsteinischen Rettungsdienstgesetzes ausdrücklich vorgegeben: „In der Notfallrettung muss im Bedarfsfall außerdem eine Ärztin oder ein Arzt eingesetzt werden“. Diese Regelung ergibt nur einen Sinn, wenn der Notarzt rechtzeitig am Einsatzort eintreffen kann. Bei einer Ausdünnung der Notarztstandorte hätte der Träger des Rettungsdienstes einen erhöhten Begründungsbedarf für seine Entscheidung, die er nicht allein mit der veränderten Krankenhausstruktur oder bestehendem Notarztmangel begründen kann. Auch in der letzten BGH-Entscheidung vom 09.01.2003 – III ZR 217/01- ist nochmals aufgeführt, dass ein funktionsfähiges Rettungswesen ohne Mitwirkung von Notärzten nicht denkbar ist.
Fazit Strukturqualität Personal
Strukturprobleme im Gesundheitswesen lassen sich nicht durch Qualitätsverzicht lösen. Es gilt vielmehr, die optimale Nutzung organisatorischer Resourcen voranzutreiben und politischen Druck zum Erhalt sinnvoller, effizienter Strukturen zu nutzen. Die Qualitätsanforderung der Zusatzweiterbildung Notfallmedizin sind für den Notarztdienst angemessen. Darüber hinaus könnten Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung einer qualifizierten Notfallversorgung sein:
– Verstärktes Nutzen der Kompetenz des Rettungsassistenten (unter den Vorgaben: 3jährige Ausbildung, Nutzen von standing-orders obligat unter Verantwortung eines ÄLRD)
– Einbindung des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes bzw. der niedergelassenen Ärzte
– Ausdehnung der Einsatzzeiten der Luftrettung
Erweiterter Rettungsdienst – Katastrophenschutz
Im Eingangsvortrag von D. Stratmann (Minden) und Hp. Moecke (Hamburg) zur Thematik wurde darauf hingewiesen, dass die Terrorangriffe des 11. September 2001 zu einer veränderten Bedrohungslage –auch in Deutschland- geführt haben, aus der Konsequenzen für die präklinische Notfallmedizin, speziell für die rettungsdienstlichen Versorgungsstrategien gezogen werden müssen (8).
Konsequenzen ergeben sich im Hinblick auf
- die mögliche Schadensgröße mit u.U. mehr als 500 Betroffenen, möglicherweise bevorzugt in Ballungsgebieten
- die Schadensart unter Einschluss von Terrorangriffen und ABC-Kampfstoffen
- die permanente Gefahr der Schädigung auch des eingesetzten Personals
Trotz der veränderten Bedrohungslage bleibt festzuhalten, dass auch bei terroristischen Angriffen einige Grundsätze der bisherigen Strategie beim „Massenanfall von Verletzten“ unverändert fortbestehen müssen. Hierzu zählen:
- die Bestrebung nach frühestmöglicher individualmedizinischer Behandlung
- die Institutionalisierung einer medizinischen Leitung (Leitender Notarzt)
- die Durchführung der Sichtung und Dokumentation nach einheitlichen Kriterien
- die Prinzipien der Bildung von Behandlungsabschnitten
- die Dislokation der Verletzten in verschiedene für das Verletzungsmuster geeignete Zielkliniken (unter frühzeitiger Nutzung der Luftrettung)
- die rechtzeitige Einbeziehung unterstützender Einheiten
Diese Unterstützung kann bisher geleistet werden durch zusätzliche regionale wie überregionale Rettungsdienstkapazitäten, die Luftrettung und sogenannte „Schnelleinsatzgruppen“ der Feuerwehren und der Hilfsorganisationen. Darüber hinaus können Kapazitäten der Bundeswehr und des Katastrophenschutzes genutzt werden.
Es besteht aber nach Meinung aller Diskussionsteilnehmer kein Zweifel, dass in erster Linie und wahrscheinlich auch für die ersten 2-3 Stunden allein der Rettungsdienst und die Feuerwehr die Schadensbewältigung durchführen müssen und hierfür geeignete (Reserve-)Kapazitäten benötigen. Dies bedeutet, dass im Hinblick auf die von der Politik in Aussicht gestellte Mittelbereitstellung diese beiden Bereiche nicht zugunsten zwangsläufig immer erst sekundär tätig werdender Dienste „vergessen“ werden dürfen.
Dennoch ist auch zukünftig eine weitere Unterstützungsmöglichkeit durch Bundeswehr und Zivil- / Katastrophenschutz absolut unverzichtbar. Im Hinblick auf die Bundeswehr ergeben sich allerdings erhebliche Zweifel, ob diese hierzu in der Lage sein wird, wenn zukünftig ausdrücklich die humanitäre Hilfeleistung im Ausland das primäre Betätigungsfeld sein soll. Dann werden zwangsläufig auch dort die Kapazitäten vorgehalten und damit im Inland im bisherigen Umfang nicht mehr zeitgerecht verfügbar sein. Insbesondere im Hinblick auf ABC-Waffen-Anschläge scheint dies nicht akzeptabel. Hier müsste dann vermehrt auf das bei den Feuerwehren vorgehaltene Potential zurückgegriffen bzw. dieses Potential ausgebaut werden.
Auch der schon länger sichtbar werdende zunehmende Rückzug der Bundeswehr aus der zivilen Rettung in Deutschland fördert sicher nicht eine problemlose Kooperation bei einem dann außergewöhnlichen Schadensfall.
Ein zukünftig effektiv und effizient tätiger Zivil- / Katastrophenschutz bedarf einer grundlegenden Strukturreform (3, 8) mit einer
- hinsichtlich der medizinischen / sanitätsdienstlichen Unterstützung deutlicher notfallmedizinischen Ausrichtung in Ausbildung und Ausstattung
- verbesserten Integration in und Kooperation mit dem Rettungsdienst
- einheitlichen Konzeption in Aufgabenstellung, Führung und Kommunikation
- Sicherstellung der gemeinsamen Zielsetzung durch eine –wie auch immer konzipierte- Bundesführung und schließlich
- Einer adäquaten Mittelzuweisung und Anerkennung ehrenamtlichen Engagements durch Staat und Gesellschaft
Die Ausbildung und die Grundstruktur der Einheiten muss sich nach dem wahrscheinlichsten Szenario richten. Es ist nicht sinnvoll und auch nicht möglich, sich auf alle erdenklichen Szenarien und jede Schadensgröße einzustellen. Vielmehr wurde in der Diskussion empfohlen, auf Kreisebene den erweiterten Rettungsdienst wie die regionalen Einheiten des Katastrophenschutzes auf die Versorgung von überschaubaren Szenarien (50-100 Betroffene, in Metropolen auch 500-1000 Betroffene) auszurichten –dies jedoch konsequent und suffizient. Ein größeres Schadensereignis müsste dann durch Zusammenarbeit der Kräfte benachbarter Kreise versorgt werden. Übungen unter obligater Einbeziehung des Rettungsdienstes sind zum Training der Zusammenarbeit essentiell.
Für besondere Schadensfälle sind spezielle „Task-Forces“ zu bilden. Der Einsatz der Einheiten muss regional und überregional möglich sein. Je nach Größe und Umfang des Schadensereignisses sollte die Koordination auch durch überregionale Einrichtungen –etwa auf Landes- oder Bundesebene- übernommen und spezielle Fachkompetenz regional wie überregional integriert werden können.
Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass Gefahrenbewältigung zwar so ortsnah wie möglich organisiert werden sollte, dass jedoch Kompetenzrangeleien mit daraus folgender erheblicher Gefährdung von Menschenleben –wie etwa aus den Erfahrungen des Elbehochwassers 2002 zu beklagen- durch suffiziente, dann auch überregionale Führungsstrukturen unterbunden werden müssen.
Fazit erweiterter Rettungsdienst – Katastrophenschutz
Die veränderte Bedrohungslage durch mögliche terroristische Angriffe zwingt zu einer Neustrukturierung des erweiterten Rettungsdienstes / Katastrophenschutzes unter Einbeziehung spezieller Kräfte (z.B. ABC-Abwehr)
Die Erstversorgung auch beim Massenanfall von Verletzten / Erkrankten erfolgt durch Rettungsdienst und Feuerwehr. Diese sind deshalb mit geeigneten Reservekapazitäten auszustatten, die zum erweiterten Rettungsdienst gehören. Ein eng verzahnte Zusammenarbeit mit den Einheiten des Katastrophenschutzes, insbesondere die Arbeit der Führungsstrukturen beider Systeme muss regelmäßig geübt werden.
Ausbildung und Grundstruktur der Einheiten muss sich nach dem wahrscheinlichsten Szenario und auf eine zu bewältigende Schadensgröße (50-100 Betroffene/Landkreis, 500-1.000 betroffene in Metropolen) richten –größere Ereignisse müssen durch Rückgriff auf benachbarte Einheiten überregional bewältigt werden. Für spezielle Schadensfälle sind überregional Spezialeinheiten („task-forces“) vorzuhalten.
Gefahrenbewältigung sollte so ortsnah wie möglich organisiert werden. Bei größeren Schadensereignissen ist eine Einsatzkoordination auf Landes- und/oder Bundesebene mit geeigneten Strukturen notwendig.
Tabelle 1
Teilnehmer der 8. Leinsweiler Gespräche
- Prof. Dr. Dr. hc F.-W. AhnefeldUniversität Ulm
- Prof. Dr. K.-H. Altemeyer Klinik für Anästhesiologie, Klinikum Saarbrücken
- LMR K.-H. Anding Bayrisches Staatsministerium des Inneren
- PD Dr. H.-R. Arntz Med. Klinik II Kardiologie und Pulmologie, Klinikum Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin
- MinR W. Brämswig Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen
- Prof. Dr. Dr. hc W.F. Dick Klinik für Anästhesiologie, Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
- Dr. Dr. B. Dirks Sektion Notfallmedizin, Klinik für Anästhesiologie, Universität Ulm
- Dr. P. Enders Mitglied des Landtages von Rheinland-Pfalz, Facharzt für Anästhesiologie
- Dr. R. Flöthner Vorsitzender der kassenärztlichen Vereinigung Saarland
- MinR G. Gräff Ministerium des Inneren und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz
- OAR H.-J. Gundlach Ministerium des Inneren und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz
- RegDir R. Hagemann Senatsverwaltung für Inneres Berlin
- MinR a.D. Dr. P. Hennes Herausgeber des Handbuches für das Rettungswesen
- Dr. F.-J. Hensel Dezernat Notfallmedizin der Bundesärztekammer
- Dr. D. Hohenadel Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch-Gladbach
- Dr. K. Jörg Saarländischer Ärzteverband
- Dr. K. G. Kanz Chirurgische Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München
- PD Dr. Chr.-K. Lackner Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Dr. M. Messelken Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Klinik am Eichert Göppingen
- Dr. Hp. Moecke Ärztlicher Geschäftsführer, Klinikum Nord, LBK Hamburg
- Dr. R. Müller Ministerium für Soziales, Frauen, Arbeit und Gesundheit des Landes Brandenburg
- Dr. S. Otto Klinik für Anästhesiologie, St.-Elisabeth-Klinik Saarlouis
- LBD Dipl.-Ing. P. Rechenbach Berufsfeuerwehr Hamburg
- Dr. R. Reeb Klinik für Anästhesiologie, Klinikum Saarbrücken
- Dr. W. Roth Ärztekammer des Saarlandes
- B. Roth Rettungszweckverband Saar
- Dr. K. Runggaldier Referat Rettungsdienst, Bundesgeschäftsstelle Malteser Hilfsdienst
- Dr. M. Ruppert Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Ludwig-Maximilians-Universität München
- ROR W. Schier Sozialministerium des Landes Hessen
- K.-H. Schindler Rettungszweckverband Saar
- Dr. Th. Schlechtriemen Klinik für Anästhesiologie, Klinikum Saarbrücken
- Dr. M. Schmidt Deutsche Krankenhausgesellschaft
- Prof. Dr. P. Sefrin Sektion Notfallmedizin, Klinik für Anästhesiologie, Universität Würzburg
- Dr. D. Stratmann Institut für Anästhesiologie, Klinikum Minden
- S. Topp Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes
- M. R. Ufer Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Göttingen
- RAss T. Wettig Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg
Literatur
1. Caffrey SL, Willoughby PJ, Pepe PE, Becker LA: Public use of Automated External Defibrillators. N Engl J Med 347 (2002): 1242-1247
2. Gundry JW , Comess KA, DeRook FA, Jorgenson D, Bardy GH: Comparison of Naïve Sixth-Grade Children with Trained Professionals in the Use of an Automated External Defibrillator. Circulation 100 (1999): 1703-1707
3. Knorr KH : Reform des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland – Ein Konzept des Deutschen Städtetages. Brandschutz 56 (2002):946
4. Lackner CK, Kanz KG, Rothenberger S, Ruppert M: AED-Anwenderperformanz von Laien- und Ersthelfern. Notfall- und Rettungsmedizin 4 (2001): 572-584
5. Lackner CK, Ruppert M, Uhl M, Reith MW, Winterberg M, Schweiberer L: Analyse von Verzögerungen und Unterbrechungen bei außerklinischer CPR Notfall und Rettungsmedizin 2 (1999): 274 – 284
6. Page RL, Joglar TA, Kuwal RC et al: Use of Automated External Defibrillators by a US airline. N Engl J Med 343 (2000): 1210-1216
7. Schäfer S, Pohl-Meuthen U: Erste-Hilfe Kenntnisse in der Bevölkerung Repräsentive Bevölkerungsbefragung 1993 und 2000. Institut für Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes, Schriftenreihe zum Rettungswesen Band 25, Verlags- und Vertriebsgesellschaft des DRK-LV Westfalen-Lippe, Nottuln
8. Stratmann D, Beneker, J., Moecke Hp, Schlaeger M: Positionspapier der BAND zur präklinischen Versorgungsstrategie des Rettungsdienstes nach den Ereignissen des 11. September 2001. Notarzt 19 (2003):37
9. Valenzuela TD, Roe DJ, Nichol G, Clark LL, Spaite DW, Hardman RG: Outcomes of rapid defibrillation by security officers after cardiac arrest in casinos. N Engl J Med 343 (2000): 1206