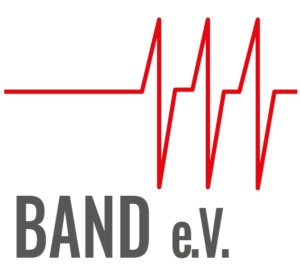7. Leinsweiler Gespräche der agswn und der BAND am 5./6. 7. 2002
Die diesjährige berufspolitische Tagung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Notärzte in Leinsweiler stand unter dem aktuellen Thema „Personal im Rettungsdienst – brauchen wir neue Konzepte?“. Teilnehmer waren Vertreter der für den Rettungsdienst zuständigen Länderministerien, der Kostenträger, der Bundesärztekammer, der Leistungserbringer im Rettungsdienst sowie der Notarztarbeitsgemeinschaften und ihrer Bundesvereinigung.
Personal im Rettungsdienst – brauchen wir neue Konzepte?
Bericht über die 7. Leinsweiler Gespräche am 05. und 06. Juli 2002
Eine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Notärzte (agswn) in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands (BAND), dem Arbeitskreis Notfallmedizin und Rettungswesen (ANR) der Ludwig-Maximilians-Universität München und dem Institut für Notfallmedizin (IfN) in Hamburg
M. Ruppert 1, R. Reeb 2, M. R. Ufer 3, D. Stratmann 4, K.-H. Altemeyer 2
1 Arbeitskreis Notfallmedizin und Rettungswesen der Ludwig-Maximilians-Universität München
2 Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Notärzte
3 Richter am Verwaltungsgericht Hannover
4 Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands
Einführung
Die diesjährige berufspolitische Tagung der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Notärzte in Leinsweiler stand unter dem aktuellen Thema „Personal im Rettungsdienst – brauchen wir neue Konzepte?“. Teilnehmer waren Vertreter der für den Rettungsdienst zuständigen Länderministerien, der Kostenträger, der Bundesärztekammer, der Leistungserbringer im Rettungsdienst sowie der Notarztarbeitsgemeinschaften und ihrer Bundesvereinigung.
Der Ärztemangel in den Krankenhäusern, der zwar regional unterschiedlich und in wechselnder Stärke zutage tritt, hat zwangsläufig auch direkte Auswirkungen auf die ärztliche Präsens im Rettungsdienst. Erste Hinweise auf diese Problematik waren bereits bei den Leinsweiler Gesprächen im Vorjahr thematisiert worden, wobei die Geschwindigkeit, mit der der Ärztemangel auch auf den Rettungsdienst durchschlägt, für viele überraschend kam.
Trotz der drängenden Probleme muss jedoch vor vorschnellen Lösungsansätzen gewarnt werden, die zum Teil aus durchsichtigen finanziellen oder auch berufspolitischen Gründen in die Diskussion eingebracht werden. Ein möglicherweise nur passagerer Mangel an Medizinern darf kein Alibi für eine Qualitätsabsenkung insbesondere der Notfallversorgung sein. Die vom Deutschen Ärztetag beschlossene Änderung der Approbationsordnung, die Neustrukturierung der ärztlichen Verantwortung in den Krankenhäusern sowie eine bessere Dienstzeitregelung sind erste Schritte, um den Arztberuf wieder attraktiver zu machen.
Für den jetzigen Zeitpunkt muss man feststellen, dass es keine Patentlösung gibt und die Probleme in den Ballungszentren andere sind als die auf dem flachen Land. Lösungsansätze für Zentren müssen anders aussehen als beispielsweise für das Kreiskrankenhaus oder für eine Notarztpraxis, wobei die Hilfsfrist auf keinen Fall zur Disposition stehen darf.
Zu fragen ist aber, ob nicht bei höherer Qualifikation der Rettungsassistenten ein längeres Zeitintervall bis zum Eintreffen des Notarztes tolerabel erscheint, wenn vom ersteintreffenden Rettungsteam diese Zeitspanne medizinisch vertretbar überbrückt werden kann. Der Patient selbst will mit Sicherheit in einer Akutsituation schnelle medizinische Hilfe, aus seiner Sicht heißt dies aber auch ärztliche Hilfe. Es muss im Interesse aller Beteiligten liegen, mit innovativen Konzepten die Qualität des deutschen Rettungsdienstes auch in Zukunft zu sichern.
Der Arzt im Rettungsdienst – 1. Tagungsrunde
Zu Beginn der von F.W. Ahnefeld (Ulm) und D. Stratmann (Minden) geleiteten Gesprächsrunde am Freitag hielt W. Dick (Mainz) ein Einführungsreferat mit dem Thema „Brauchen wir noch einen Notarzt oder brauchen wir einen anderen Notarzt?“
Blickt man in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Deutschland beispielsweise auf das amerikanische Rettungsdienstsystem, so ist dieses sog. Paramedic-System 1963 nicht aufgrund der Überzeugung entstanden, dass es besser sei als ein arzt-gestütztes System, sondern sowohl aus ökonomischen Gründen als auch aus einem relativen Mangel an verfügbaren Ärzten. So konstatieren amerikanische Notfallmediziner heute, dass das deutsche Notarztsystem aufgrund des besseren medizinischen Know-hows günstigere Behandlungsmöglichkeiten bietet und eine genauere prähospitale Triage erlaubt. Insgesamt kann die Frage „Brauchen wir noch einen Notarzt?“ gegenwärtig eindeutig mit „Ja“ beantwortet werden.
Bei einer zukünftig verbesserten Aus- und Weiterbildung der Rettungsassistenten muss dann die Frage gestellt werden, wofür genau wir den Notarzt noch brauchen. Anhand des tatsächlichen Notfallspektrums und der gängigen notfallmedizinischen Behandlungsmaßnahmen muss untersucht werden, für welche Bereiche der Notarzt noch exklusiv zuständig bleiben wird.
Betrachtet man das Gesamteinsatzaufkommen des Rettungsdienstes, so werden schon heute nur etwa ein Drittel der Notfälle vom Notarzt versorgt. Der Anteil so genannter Notsituationen am Notarzteinsatzaufkommen beträgt ca. 30 bis 40 %. Diese Notsituationen könnten durch den Hausarzt und den Rettungsdienst ohne Notarzt effektiv behandelt werden. Somit bleiben rein rechnerisch 60 bis 70 % „echte“ Notfallindikationen für den Notarzt übrig. Dieses sind die komplexeren Krankheitsbilder, wie z.B. der Herzinfarkt, akute Rhythmusstörungen, der Schock jeglicher Genese, das Schädel-Hirn- oder Polytrauma sowie alle Komaformen. Die in diesen Fällen indizierten Therapiemaßnahmen sind häufig solche des Arztvorbehaltes, wie z.B. eine EKG-gestützte antiarhythmische Behandlung, die Lysetherapie, Narkoseeinleitung und -führung, differenzierte Beatmung oder die Thoraxdrainagenanlage.
Vor diesem Hintergrund muss auch die Frage gestellt werden, ob es hierfür eine ausreichende Zahl genügend gut qualifizierter Notärzte gibt. Ein Schritt in Richtung Qualitätssteigerung ist die bereits in einigen Bundesländern eingeführte Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“. Der gegenwärtige Ärztemangel darf diese Bemühungen der vergangenen Jahre nicht zunichte machen.
Aus den vorgenannten Überlegungen ergeben sich folgende Konsequenzen:
- Die Zahl der echten Notarztindikationen wird sich deutlich verringern, wenn Hausärzte ihren Verpflichtungen verstärkt nachkommen und Rettungsassistenten eine Regelkompetenz erwerben, die sie unter entsprechender Aufsicht und Qualitätssicherung anwenden.
- Der zukünftige Notarzt wird dann vorwiegend mit komplexen Notfallsituationen befasst, die ein höheres Qualifikationsniveau verlangen, als dies momentan mitunter der Fall ist.
- Die außer- und innerklinische Notfallversorgung muss zunehmend verzahnt und idealerweise durch dieselben Personen durchgeführt werden.
W. Dick plädiert deshalb dafür, eine Supraspezialität „Notfallmedizin“ mit einer höheren Qualifikation und Ausweitung des Aufgaben- und Kompetenzbereiches zu schaffen. Der Zugang hierzu sollte auf klinische Spezialisten der Bereiche Anästhesiologie, Chirurgie, Innere Medizin und Pädiatrie begrenzt werden. Ebenso wie der Supraspezialist für die Intensivmedizin hauptamtlich und längerfristig tätig ist, muss dies auch für einen Supraspezialisten in der Notfallmedizin gelten. Es müssen Strukturen geschaffen werden, um den Arzt in der Notaufnahme identisch wie den Notarzt neuer Prägung zu qualifizieren. Im Rahmen der Reorganisation der Facharztweiterbildung wird von der Bundesärztekammer und den Fachgesellschaften über einen Bereich Notfallmedizin ähnlich wie einen Bereich Intensivmedizin nachgedacht. Voraussetzung dafür wäre mindestens das Weiterbildungsprogramm des so genannten „Münsteraner Kompromisses“.
Zusammengefasst brauchen wir mehr denn je einen Notarzt, aber wir brauchen einen kompetenteren Notarzt für komplexere Aufgabenstellung im Bereich der prä- und innerklinischen Notfallmedizin.
In der nachfolgenden Diskussion weist K. Anding (München) auf mögliche Folgen der Einführung der Diagnose Related Groups (DRG) auf die Notarztsysteme hin. Würden Krankenhäuser geschlossen, käme es zu einer Konzentration auf weniger Notarztstandorte, die eine Änderung der Einsatztaktik erforderlich mache. Insbesondere die Luftrettung müsse dann vermehrt in der Fläche eingesetzt werden, um die notärztliche Präsenz zu gewährleisten.
B. Dirks (Ulm) weist darauf hin, dass die Erhöhung der Einsatzspezifität nicht zwangsläufig bedeutet, dass weniger Notärzte erforderlich sind. Die Vorhaltung richtet sich nicht nach den Einsatzzahlen sondern nach der erforderlichen Hilfsfrist.
Nach Meinung von Hp. Moecke (Hamburg) ist es nicht das erstrebenswerte Ziel, Notarzteinsätze zu vermeiden, die eher dem Bereich der kassenärztlichen Versorgung zuzurechnen sind, sondern die Notärzte gerade auch für solche Einsätze besser zu qualifizieren. Es werde auch künftig keinen anderen Dienstleister geben, der derartige Einsätze übernehmen möchte. Demgegenüber argumentierte K.-H. Altemeyer (Saarbrücken), dass Aufgaben des kassenärztlichen Notdienstes nur dort überhaupt übernommen werden können, wo es zukünftig noch Notärzte gäbe. Die Problematik des Notarztmangels in der Fläche lässt sich teilweise durch eine konsequente Erstversorgung der Notfallpatienten durch First-Responder-Systeme und qualifizierte Rettungsassistenten kompensieren, wenn dann – Tag und Nacht – durch entsprechend ausgeweitete Luftrettungssysteme eine weitere notärztliche Behandlung des Patienten sichergestellt werden kann und der so stabilisierte Patient in ein entsprechendes notfallmedizinisches Zentrum transportiert werden kann.
M. R. Ufer (Hannover) beklagt, dass die Landesärztekammern die Qualifikation der Notärzte (Fachkunde bzw. Zusatzbezeichnung) bislang abweichend festgelegt haben. Daneben bestimmen die Bundesländer die erforderliche Qualifikation der auf den Rettungsmitteln tätigen Notärzte ebenfalls uneinheitlich. Beide Faktoren bewirken, dass gegenwärtig kein einheitliches Anforderungsprofil an die Qualifikation des Notarztes im Rettungsdienst besteht und die Mobilität der Notärzte zwischen den einzelnen Bundesländern eingeschränkt sei. Er fordert daher eine länderübergreifende Anerkennung von notärztlichen Qualifikationen und Zugangsvoraussetzungen zum Notarztdienst unter Einbeziehung des Intensivtransports.
D. Stratmann fasst abschließend zusammen, dass eine Absenkung des Qualifikationsniveaus für Notärzte die Zahl der zur Verfügung stehenden Notärzte nicht erhöhen wird. Da in Zukunft weniger Notärzte vermehrt für komplexere Notfallsituationen eingesetzt werden müssen, ist umgekehrt eine erhebliche Qualifikationssteigerung erforderlich. Eine bessere Vernetzung des Notarztdienstes mit dem kassenärztlichen Notdienst kann Synergieeffekte nutzbar machen. Hierzu müssen Integrierte Leitstellen beide Dienste steuern können. Eine verbesserte Qualifikation der Rettungsassistenten kann helfen, den Notarztmangel in der Fläche bei gewissen Notfallsituationen zumindest partiell auszugleichen.
Der Rettungsassistent neuer Prägung – 2. Tagungsrunde
Die zweite Gesprächsrunde am Samstag unter Vorsitz von B. Dirks (Ulm) und S. Topp (Berlin) steht unter der Thematik der Kompetenzerweiterung von Rettungsassistentinnen und –assistenten im Hinblick auf die Novellierung des Rettungsassistentengesetzes (RettAssG) und die zukünftige Verlängerung der Ausbildung auf 3 Jahre.
Zunächst berichtet K.-H. Altemeyer über das bereits im März 2000 stattgefundene Treffen „Primat im Rettungsdienst“, als dessen Ergebnis neben der Voraussetzung einer dreijährigen Ausbildung wesentliche Rahmenbedingungen zur Überführung von ärztlichen Maßnahmen in die Regelkompetenz der Rettungsassistenten formuliert worden waren.
Die Kontrollfunktion des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) und ein konsequentes Qualitätsmanagementsystem sowie die kontinuierliche Fortbildung des Rettungsdienstpersonals stellen elementare Voraussetzungen für eine Kompetenzerweiterung dar.
B. Gliwitzky (Mainz) stellt aus Sicht einer Rettungsassistentenschule dar, dass bereits heute die konsequente Aus- und Fortbildung der Notkompetenzmaßnahmen zu einem verantwortungsbewussten Umgang des Rettungsdienstpersonals mit diesen erweiterten Maßnahmen geführt hat.
Voraussetzung für die Überführung in eine Regelkompetenz sei aus seiner Sicht eine in den Ländergesetzen festgeschriebene Fortbildungsverpflichtung sowie die kontinuierliche Rezertifizierung der Mitarbeiter durch den jeweiligen, beim Aufgabenträger angesiedelten, Ärztlichen Leiter Rettungsdienst.
Als mögliche Maßnahmen werden neben den jetzigen Notkompetenzmaßnahmen gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer bzw. den Maßnahmen des im Folgenden vorgestellten Diskussionspapiers der BAND einige weitere Optionen genannt. Hierzu gehören beispielsweise das Erlernen einer Alternativtechnik zur endotrachealen Intubation (z. B. die Larynxmaske), die intravenöse Gabe von Benzodiazepinen beim Krampfanfall sowie bei schweren Schmerzzuständen die intravenöse Applikation des Analgetikums Ketamin in Kombination mit einem kurzwirksamen Benzodiazepin.
Aus Sicht der Schulen erscheint es durchaus vorstellbar, dass im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen ÄLRD unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten zusätzlich weitere ärztliche Maßnahmen durch erfahrene Rettungsassistenten angewandt werden könnten. Dies bedürfte der „Erlaubniserteilung“ durch den ÄLRD auf der personenbezogenen Anwenderebene und einer strengen Qualitätskontrolle und Rezertifizierung jedes einzelnen Mitarbeiters in jeder der jeweiligen Maßnahmen.
Die Vermittlung derartiger Maßnahmen sollte im Rahmen der dreijährigen Ausbildung erfolgen, die Durchführungserlaubnis und die Überprüfung der Qualifikation läge dabei in den Händen des ÄLRD im jeweiligen Rettungsdienstbereich unter Berücksichtigung der lokalen Strukturen und Erfordernisse.
D. Stratmann stellt das Diskussionspapier der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands (BAND) zur Regelkompetenz des Rettungsassistenten vor, das nach der Meinungsbildung und Konsensfindung während der Leinsweiler Gespräche in dieser Ausgabe von Notfall&Rettungsmedizin als Positionspapier der BAND publiziert ist. Er betont, dass das vorgelegte Papier hier bewusst als Diskussionsgrundlage eingebracht wird, um es unter Berücksichtigung möglichst aller Aspekte und auf der Grundlage eines möglichst breiten Konsenses im Anschluss als Positionspapier zu publizieren.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich dieses Papier lediglich auf die Novellierung des
RettAssG bezieht, nicht aber weiterführende Regelungen zur Etablierung zusätzlicher ärztlicher Maßnahmen aufgrund individueller Festlegungen durch den jeweiligen ÄLRD, wie es bereit von B. Gliwitzky dargestellt worden war, beinhaltet.
D. Stratmann erinnert kurz an die Meilensteine der bisherigen Bemühungen zur Novellierung des Rettungsassistentengesetzes wie das Reisensburger Memorandum von 1996 und den zweiten Reisensburger Workshop des ANR vom Dezember des vergangenen Jahres. Im Rahmen der zukünftigen dreijährigen Ausbildung sollen nun Maßnahmen der bisherigen „Notkompetenz“ in eine neue Regelkompetenz überführt werden, wobei auch hier als wesentliche Voraussetzungen die eindeutigen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie ein ärztliches Qualitätsmanagementsystem in Aus- und Fortbildung sowie Anwendung gefordert werden.
Diese Regelkompetenz beinhaltet neben einer Grundkompetenz die Integration ärztlicher Maßnahmen als erweiterte Kompetenzmaßnahmen, die dann konsequenterweise auch Bestandteil der Prüfung zum Rettungsassistenten seien müssen. Um auch hier einen einheitlichen Qualitätsstandard zu erreichen, bedarf es der direkten staatlichen Aufsicht über die Bildungseinrichtung sowie der ärztlichen Fachaufsicht innerhalb der jeweiligen Schulleitung. Bereits ausgebildetes Rettungsdienstfachpersonal muss die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten in einer analogen Prüfung nachweisen, um eine Anerkennung gemäß den Bestimmungen des neuen Rettungsassistentengesetzes zu erlangen – eine Übergangsregelung analog zum jetzigen RettAssG ist obsolet.
Auch im Diskussionspapier der BAND wird weiterhin formuliert, dass die Anwendung der erweiterten Kompetenz einer Weisungsberechtigung und Fachaufsicht durch den ÄLRD bedarf. Diese Fachaufsicht beinhaltet auch die Überprüfung, ob Maßnahmen der Regelkompetenz bei entsprechender Indikation im Einsatz auch tatsächlich indiziert und angewandt werden. Die Indikationsstellung und Anwendung der Maßnahmen soll auf der Basis festgelegter Algorithmen erfolgen, die den Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften entsprechen müssen.
Weiterhin werden Voraussetzungen für die zukünftige Qualifizierung zur Regelkompetenz dargestellt. Neben der dreijährigen Vollausbildung mit Wechsel von theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitten werden als Eingangsvoraussetzungen ein Schulabschluss mit Mittlerer Reife oder eine abgeschlossene Lehre sowie ein Mindestalter bei Ausbildungsbeginn von 17 Jahren gesehen. Ein einheitlich verbindliches Curriculum für theoretische und praktische Unterrichtsanteile sowie die Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung stellen Kernpunkte dieses neuen Ausbildungskonzeptes dar.
Insgesamt stellt die Erweiterung der Kompetenz keinen Einstieg in ein notarztfreies Rettungsdienstsystem dar und erfordert vom Rettungsassistenten ein erhebliches Maß an Verantwortungsbewusstsein für seine Tätigkeit.
Im vierten Referat stellt M. R. Ufer die Einordnung des Rettungsassistenten neuer Prägung in das System der Heilberufe aus der Sicht des Juristen dar.
Er führt aus, dass die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde im System des deutschen Heilberuferechts Ärzten, zugelassenen Heilpraktikern, Zahnärzten usw. vorbehalten ist. Im Rettungsdienst spielt dabei nur der Arzt eine Rolle. Alle anderen Berufe stellen Heilhilfsberufe dar, hierzu zählt u. a. die Krankenschwester und der Rettungsassistent, dessen Berufszugang seit 1989 durch Bundesrecht im RettAssG geregelt wird. Die Einzelheiten der Ausbildung und Prüfung werden in der dazugehörigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (RettAssAPrV) geregelt. Die Einordnung des Berufs des Rettungsassistenten als Heilhilfsberuf (modern ausgedrückt: medizinischer Assistenzberuf oder medizinischer Fachberuf) wird sowohl durch die Berufsbezeichnung Rettungsassistent als auch durch die in der Ausbildungszielbestimmung des § 3 RettAssG enthaltene Formulierung „entsprechend der Aufgabenstellung des Berufs als Helfer des Arztes“ deutlich. Diese berufliche Stellung erfordert vom Rettungsassistenten, dass er die Behandlung des Notfallpatienten noch am Einsatzort in die Hände des Arztes legt, wenn ärztlicher Sachverstand erforderlich ist oder invasive Maßnahmen durchzuführen sind. Dieses Grundverständnis wird auch in § 3 RettAssG deutlich, wenn es dort heißt, dass der Rettungsassistent dazu zu befähigen ist, „am Notfallort bis zur Übernahme der Behandlung durch den Arzt lebensrettende Maßnahmen an Notfallpatienten durchzuführen“. Nur wenn der Arzt nicht (rechtzeitig) erreichbar ist, muss und darf der Rettungsassistent im Rahmen seiner von Rechtsprechung und Schrifttum anerkannten Notkompetenz im Regelfall dem Arzt vorbehaltene Maßnahmen durchführen. Durch die Begriffswahl der gesetzlich nicht geregelten „Notkompetenz“ wird deutlich, dass bei dieser Ausgestaltung des Berufsbildes das System des deutschen Heilberuferechts nicht geändert werden muss und das im Rettungsdienst bestehende ärztliche Behandlungsmonopol nicht angetastet wird (vgl. BT-Drs. 11/2275, S. 9 S. 9 zum RettAssG 1989).
In der berufspolitischen Diskussion um einen zukünftig über drei Jahre ausgebildeten Rettungsassistenten ist nun verstärkt von „eigenständigen Tätigkeitsmerkmalen“ und von einer „Regelkompetenz“ bzw. „Eigenkompetenz“ die Rede. Deshalb stellt sich die Frage nach der Einordnung eines Rettungsassistenten neuer Prägung in das bestehende System der Heilberufe. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das klassische Verhältnis Arzt – Heilhilfsberuf mit der Stellung der Hebamme/des Entbindungspflegers eine Ausnahme enthält. § 4 HebG weist der Hebamme im Verhältnis zum Arzt eigene Kompetenzen zu, und in Dienstordnungen wird die Zusammenarbeit mit dem Arzt geregelt.
Dies vorausgeschickt, bestehen aus rechtlicher Sicht drei Varianten, das Verhältnis zu ordnen:
-Variante 1 § 3 RettAssG (Ausbildungszielbestimmung) bleibt unverändert. Da die RettAssAPrV gegenwärtig keine ausdrücklich bezeichneten Maßnahmen enthält, erfolgt auch hier keine Änderung.
-Variante 2 § 3 RettAssG wird dahingehend neu formuliert, dass die Ausbildung des Rettungsassistenten auch die eigenständige Durchführung nach heutigem Verständnis erweiterter Maßnahmen umfasst. Die Anlage 1 (und ggf. 2) zu § 1 Abs. 1 RettAssAPrV wird angepasst. Das System der Heilberufe bleibt unverändert.
-Variante 3 Ähnlich § 4 HebG wird dem Rettungsassistenten ein eigenständiger Behandlungsbereich zugeordnet. In das RettAssG wird vor § 3 eine neue Vorschrift aufgenommen, die lauten könnte (Rohentwurf zur Notfallrettung): „Aufgabenbereich: Der Rettungsassistent führt lebensrettende Maßnahmen durch. Bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten zieht er einen Notarzt hinzu, wenn dieser nicht bereits von der Rettungsleitstelle zum Einsatzort entsandt worden ist, und wirkt an der weiteren Behandlung nach Weisung des Notarztes mit“. § 3 RettAssG wird ebenso geändert wie die RettAssAPrV.
Bei allen Varianten ist zu berücksichtigen, dass die Bevölkerung den Einsatz eines Notarztes bei lebensbedrohlichen Situationen noch am Einsatzort erwartet. Außerdem muss der Notarzt erkennen können, ob er am Einsatzort auf einen über drei Jahre ausgebildeten oder nur auf einen über zwei Jahre ausgebildeten Rettungsassistenten trifft. Die Notkompetenzfrage wird auch durch eine Novellierung des RettAssG nicht endgültig gelöst werden. Sie wird sich nach wie vor bei dem nach gegenwärtiger Rechtslage ausgebildeten bzw. nach § 13 RettAssG übergeleiteten Rettungsassistenten und dem nach Landesrecht über 520 Stunden ausgebildeten Rettungssanitäter stellen. Zudem bestimmen die Länder, mit welchem Personal die Rettungsmittel zu besetzen sind.
Im Zusammenhang mit der „Regelkompetenz“ des zukünftigen Rettungsassistenten wird häufig von „Delegation“ gesprochen. Hierzu merkt M. R. Ufer an, dass auch dieser Begriff gesetzlich nicht geregelt ist. Die Delegation ist allerdings als Element der Arbeitsteilung im Medizinrecht anerkannt. Ist eine Maßnahme wegen ihrer eher einfachen Natur delegationsfähig, muss der Arzt den nichtärztlichen Mitarbeiter überwachen und anwesend bzw. schnell erreichbar sein (Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des ArztR, S. 641 Rdnr. 12). Nicht delegationsfähig sind damit die Diagnosestellung und die Therapieentscheidung. Im Einzelfall delegationsfähig ist die Durchführung von Maßnahmen auf den entsprechend ausgebildeten Rettungsassistenten, wobei dies die Anwesenheit des Notarztes am Einsatzort voraussetzt.
Eine vom Einzelfall und der (bisherigen) Notkompetenz abgekoppelte „General“-Delegation ist in der Rechtsprechung noch nicht anerkannt und für den Bereich der Notfallmedizin problematisch. Eine sich auf unterschiedliche Maßnahmen erstreckende „General“-Delegation nach Maßgabe des jeweiligen ÄLRD und den Erfordernissen des Rettungsdienstbereichs (unterschiedliche Eintreffzeiten des Notarztes) ist abzulehnen. Sie widerspräche dem Ziel der Herstellung einer Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse, erschwert die haftungsrechtliche Zuordnung und führt zu Erschwernissen bei rettungsdienstbereichsübergreifenden Einsätzen.
Zuletzt geht M.R. Ufer auf Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen ein, die sich ergeben, wenn sich in Zukunft möglicherweise der Zeitraum verlängert, den Rettungsassistenten bis zum Eintreffen des Notarztes am Einsatzort alleinverantwortlich überbrücken müssen. Die Zuerkennung einer „Eigenkompetenz“ in Bereichen, die bislang dem Arzt zugeordnet wurden, wird dann dazu führen, dass weniger von überobligatorischem Verhalten des Rettungsassistenten, sondern mehr von geschuldetem Verhalten gesprochen wird. Die bislang als Ausnahmefall angesehene Situation wird dann zum Regelfall. Zivilrechtlich haftet hier der Rettungsdienstträger, wenn Amtshaftungsgrundsätze angewandt werden. Ansonsten haftet die Hilfsorganisation und der Rettungsassistent gesamtschuldnerisch.
Von einem über drei Jahre ausgebildeten Rettungsassistenten wird die Ausführung einer Maßnahme in einer Qualität erwartet, die nahe an die an einen Notarzt zu stellenden Anforderungen heranreicht.
In der folgenden Diskussion um die grundsätzlichen Optionen der Gesetzesänderung und die Einordnung des RettAssG in das Heilberuferecht wird unter anderem thematisiert, dass ein zentraler Punkt die Darstellung des Verhältnisses von Rettungsassistenten und Notarzt ist. Dies hat wiederum Einfluss auf die Frage der Notarztnachalarmierung bei Anwendung erweiterter Maßnahmen und damit letztlich auch Einfluss auf die Notarzteinsatz-Indikationskataloge.
Hp. Moecke erinnert, dass die Regelungen auch eine Durchgängigkeit mit anderen medizinischen Assistenzberufen aufweisen sollten. Dabei werden auch visionäre Konzepte andiskutiert, die – analog zum ärztlichen Personal – eine zunehmende Vernetzung der präklinischen und klinischen Notfallmedizin auch für das Assistenzpersonal im Hinblick auf eine bessere Qualifizierung und Kontrolle als einen zukunftsweisenden Ansatz erscheinen lässt.
Insgesamt scheint die Möglichkeit einer Umformulierung des § 3 RettAssG im Sinne des neuen Ausbildungsziels die größte Zustimmung zu finden (Variante 2).
Im Rahmen der Diskussion der einzelnen Maßnahmen einer erweiterten Kompetenz betont D. Stratmann nochmals, dass die dargestellten Vorschläge für den Berufsanfänger und als prüfungsrelevante Themen gelten, nicht aber für den erfahrenen, gegebenenfalls weiterqualifizierten Rettungsassistenten. Detaillierte Regelungen für Indikationsstellung und Durchführung müssen in einzelnen Algorithmen („Standing orders“) geregelt werden, was unter anderem auch die Wahl eines spezifischen Analgetikums angeht.
Erhöhter Diskussionsbedarf besteht beim formulierten Mindestalter von 17 Jahren. Insbesondere von Seiten der Leistungserbringer wird ein Mindestalter von 18 Jahren als notwendig angesehen, um die Auszubildenden frühzeitig als Rettungssanitäter einsetzen zu können und damit die Kosten der Ausbildung möglichst gering zu halten. Dies sei insbesondere bei der Durchsetzung der Gesetzesnovellierung gegenüber den Kostenträgern ein wesentlicher Punkt. Ein höheres Mindestalter bei Ausbildungsbeginn hat umgekehrt aber zur Folge, dass durch die Pause zwischen Ende der Schulausbildung und Beginn der Berufsausbildung potenzielle Interessenten für den Beruf verloren gehen könnten und dass im Sinne der Durchgängigkeit mit anderen Heilhilfsberufen das Alter von 17 Jahren hier so definiert worden ist. Es wird außerdem geäußert, dass bei der Formulierung eines solchen Grundsatzpapiers nicht ökonomische Gesichtpunkte in den Vordergrund gestellt werden sollten.
Zum Abschluss der Sitzung stellt S. Topp unterschiedliche Finanzierungsmodelle für eine dreijährige Ausbildung zum Rettungsassistenten dar. Zusammenfassend wäre eine fast kostenneutrale Lösung mit unterschiedlichen Modellen einer Aufteilung zwischen theoretisch-praktischer Ausbildung, klinischer Ausbildung und Rettungswachenpraktikum darstellbar, wenn ein ausreichender Einsatz des Auszubildenden als Rettungssanitäter möglich ist.
Wesentlicher Diskussionspunkt stellt hier die offensichtliche Gefahr des „Missbrauchs“ des Auszubildenden als Arbeitskraft unter Hintanstellung des Ausbildungsauftrages auf der Rettungswache dar, dem zwingend durch ein definiertes Curriculum und eine klare Ausbildungsstruktur begegnet werden muss. Länderübergreifende, einheitliche Rahmenbedingung für die klinische Ausbildung und das Rettungswachenpraktikum, die unter der Verantwortung der jeweiligen Schule liegen müssen, stellen einen zentralen Punkt für die qualifizierte Weiterentwicklung der Ausbildung dar.
B. Dirks spricht abschließend die Hoffnung aus, dass der bestehende Konsens zu den zentralen Punkten der Novellierungen des Rettungsassistentengesetzes hier in Leinsweiler eine Umsetzung in naher Zukunft realistisch erscheinen lässt.